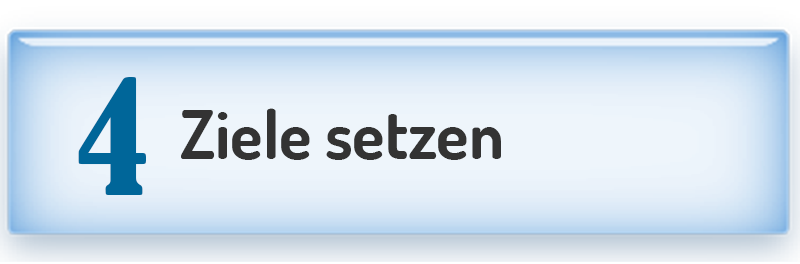|
3. Die allererste Stunde gestalten
1. Akzeptiert Aufregung!
2. Bereitet die Sitzordnung vor! Vielleicht fällt euch der Einstieg leichter, wenn ihr vor euren Schüler*innen im Raum seid und Tische und Stühle schon einmal so stellen könnt, wie ihr sie gerne hättet. So verhindert ihr auch, dass eure Schüler*innen sich im ganzen Raum verteilen und eure erste Aktion eine (unter Umständen sehr lehrerhaft anmutende) Umsetzung ist. Für die erste Stunde ist in jedem Fall anzuraten, dass ihr euch gemeinsam an einen (großen) Tisch setzt. Es erleichtert das Kennenlernen ungemein, wenn alle das Gefühl haben, dass sie zusammensitzen. Später kann die Sitzordnung sicher auch variiert werden. Wenn ihr viel an der Tafel arbeitet, ist es oft besser, wenn alle Schüler mit dem Gesicht zur Tafel sitzen. Folgendes solltet ihr immer beachten:
Natürlich könnt ihr von Zeit zu Zeit auch einmal die Sitzordnung verändern. Niemand sollte auf seinem Stuhl festwachsen. Auch innerhalb einer Stunde kann eine Veränderung sinnvoll sein. 3. Nehmt euch Zeit fürs Kennenlernen! Die allererste Stunde beginnt selbstverständlich mit dem Kennenlernen: Jeder stellt sich kurz vor. Dabei dürfen auch persönliche Vorlieben, Hobbies, Stärken und Schwächen zur Sprache kommen: Was macht ihr in eurer Freizeit? Wo wohnt ihr? Was könnt ihr besonders gut? Von welchem Thema habt ihr besonders viel Ahnung? – Solche Fragen könnt ihr als Anregung für die Selbstvorstellung vorgeben. Sinnvoll ist sicher auch, wenn ihr Schullust und -frust thematisiert – insbesondere im Blick auf das Unterrichtsfach, um das ihr euch kümmert. Ihr solltet also nicht sofort geschäftsmäßig „zur Sache kommen“. Nehmt euch Zeit, ein Bild von den Schüler*innen zu gewinnen, mit denen ihr es zu tun bekommt.
4. Ermittelt den Förderbedarf! „Warum seid ihr hier?“ Wenn eure Schüler*innen diese Frage nicht bereits in der Vorstellungsrunde von selbst beantwortet haben, so wäre sie spätestens jetzt dran. Ihr müsst herausfinden, wo die Schwierigkeiten liegen; was zu wiederholen und zu üben ist. Ihr müsst – am besten gemeinsam mit den Schüler*innen – klären, was in dieser und in den nächsten Stunden geschehen soll. Gelegentlich sind die Selbstauskünfte der Schüler*innen zum Förderbedarf wenig hilfreich. „Ich versteh eigentlich immer alles, schreibe aber in letzter Zeit immer schlechte Arbeiten.“, bekommt ihr vielleicht zu hören und seid damit nicht wesentlich schlauer als vorher. Wenn eure Schüler*innen von selbst keinen konkreten Förderbedarf benennen können, müsst ihr selbst ermitteln. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Oft geht es nicht nur um kleinere, schnell zu schließende Stofflücken. Oft geht es um grundsätzlichere Defizite: z.B. die Unfähigkeit Interesse zu entwickeln, sich zu motivieren, strukturiert zu arbeiten, mit sinnvollen Techniken zu lernen. Auch hieran müsst ihr arbeiten. Wenn ihr mehrere Schüler*innen betreut, habt ihr es in der Regel mit unterschiedlichen Lernproblemen zu tun. Achtet darauf, dass ihr bei der Ermittlung des Förderbedarfs alle Schüler*innen gleichermaßen berücksichtigt, nicht nur die dominanteren, sondern auch die stilleren. Wenn ihr eine Gruppe habt, in der die Bedürfnisse auseinander gehen, müsst ihr auch überlegen, ob ihr nicht unterschiedliche Lernangebote macht. 5. Warnt vor überzogenen Erwartungen!
Natürlich können kleinere Probleme mit dem aktuellen Stoff schnell behoben werden, aber meist geht es ja um mehr als das. Da braucht es einen langen Atem und vor allem gute Mitarbeit. Nebenbemerkung: Auch ihr solltet euch nicht unter Druck setzen: Natürlich ist eine Leistungssteigerung der Schüler*innen, die sich auch in den Leistungsbewertungen niederschlägt, ein Indiz dafür, dass ihr gut unterrichtet habt. Aber der Umkehrschluss gilt nicht: Wenn sich die Leistungen eurer Schüler*innen nicht verbessern, heißt das nicht, dass ihr schlecht gearbeitet habt. Ausbleibender Erfolg kann viele Ursachen haben: Die häufigsten sind fehlende Lernbereitschaft und eine grundsätzliche Überforderung. 6. Vereinbart Spielregeln! Damit Förderunterricht gut funktioniert, müssen sich alle Beteiligten an grundsätzliche Spielregeln halten. Die meisten dieser Regeln sind allen klar, ohne dass sie jemals angesprochen wurden. Zum Beispiel:
Anders ist es mit Regeln zu typischen Konfliktpunkten. Je früher ihr hierzu klare Vereinbarungen trefft, desto größer die Chance, mögliche Konflikte zu vermeiden. Deshalb solltet ihr am besten schon in der ersten Stunde einige klärende Worte sprechen. Regeln könnten zum Beispiel sein:
7. Kommt zur Sache! Vielleicht ist nach der Ermittlung des Förderbedarfs und der Vereinbarung der Spielregeln die Zeit schon abgelaufen. Das wäre nicht schlimm. Besser wäre allerdings, wenn ihr schon in der ersten Stunde einige Angebote machen könntet, die euren Schüler*innen ein Gefühl dafür geben, dass und wie der Förderunterricht hilft. Wenn es euch nicht gelungen ist, im Vorfeld von der Fachlehrkraft eurer Schüler*innen Hinweise zum Lernbedarf zu erhalten, habt ihr jetzt 2 Möglichkeiten:
|
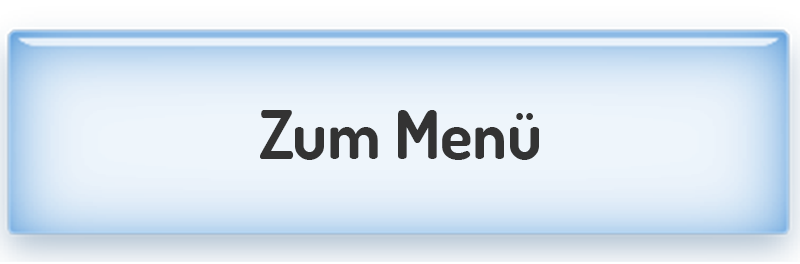
 Die
allererste Stunde ist für alle Beteiligten aufregend. Wenn ihr vor
der Stunde feuchte Hände habt, im Magen ein leichtes Rumoren
verspürt oder errötet, sollte euch das nicht irritieren. Das gehört
dazu. Auch ausgewachsene Lehrer*innen kennen diese Begleiterscheinungen
beim „ersten Mal“.
Die
allererste Stunde ist für alle Beteiligten aufregend. Wenn ihr vor
der Stunde feuchte Hände habt, im Magen ein leichtes Rumoren
verspürt oder errötet, sollte euch das nicht irritieren. Das gehört
dazu. Auch ausgewachsene Lehrer*innen kennen diese Begleiterscheinungen
beim „ersten Mal“. Wenn
ihr mit euren Schüler*innen ausschließlich über Fachliches redet,
signalisiert ihr Desinteresse an ihrer Person – und das kann euch
als mangelnder Respekt ausgelegt werden.
Wenn
ihr mit euren Schüler*innen ausschließlich über Fachliches redet,
signalisiert ihr Desinteresse an ihrer Person – und das kann euch
als mangelnder Respekt ausgelegt werden. 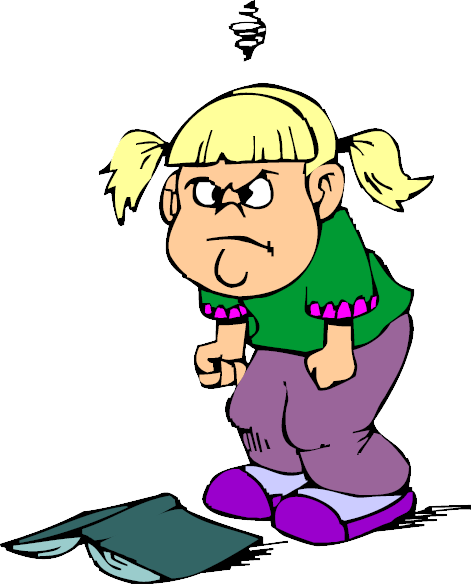 Manchmal erwarten Schüler von ihrem Förderunterricht eine Art
Wunderheilung. Innerhalb weniger Stunden sollen sämtliche
Lern-schwierigkeiten behoben sein. Solche Erwartungen solltet ihr dämpfen.
Manchmal erwarten Schüler von ihrem Förderunterricht eine Art
Wunderheilung. Innerhalb weniger Stunden sollen sämtliche
Lern-schwierigkeiten behoben sein. Solche Erwartungen solltet ihr dämpfen. Wenn
es hier nicht irgendwann einmal zu Problemen kommen sollte, brauchen
diese unausgesprochenen, allgemein gültigen Verhaltensregeln nicht
thematisiert zu werden.
Wenn
es hier nicht irgendwann einmal zu Problemen kommen sollte, brauchen
diese unausgesprochenen, allgemein gültigen Verhaltensregeln nicht
thematisiert zu werden. wie sie für das
Fach, um das ihr euch kümmert, lernen. Ob sie zufrieden sind mit
ihrer Lerntechnik. Oder ob sie Verbesserungsmöglichkeiten sehen.
Sicherlich könnt ihr eigene Ideen und Erfahrungen einbringen.
wie sie für das
Fach, um das ihr euch kümmert, lernen. Ob sie zufrieden sind mit
ihrer Lerntechnik. Oder ob sie Verbesserungsmöglichkeiten sehen.
Sicherlich könnt ihr eigene Ideen und Erfahrungen einbringen.
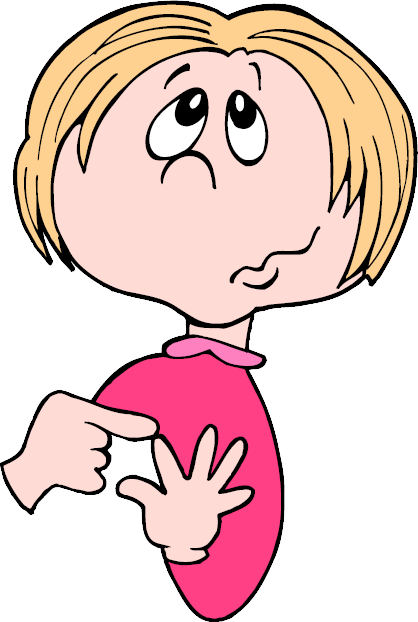 Vielleicht habt ihr ein vorbereitetes Blatt mit Tipps zur
Lerntechnik. Und eventuell kann euer Gespräch in eine konkrete
Vereinbarung münden, eine bestimmte Lerntechnik einmal
auszuprobieren.
Vielleicht habt ihr ein vorbereitetes Blatt mit Tipps zur
Lerntechnik. Und eventuell kann euer Gespräch in eine konkrete
Vereinbarung münden, eine bestimmte Lerntechnik einmal
auszuprobieren.