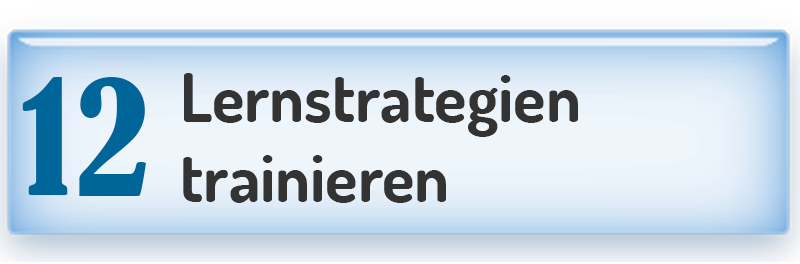|
11. Auf Störungen reagieren
1. Nicht die Ruhe verlieren!
Auch solltet ihr niemals eine*n Schüler*in vor der Gruppe bloßstellen. Eine Bloßstellung wird in der Regel als Kampfaufruf verstanden und provoziert mehr oder weniger offene Gegengewalt. Ein solches Kräftemessen ist sehr anstrengend und vor allem völlig unnütz. 2. Bauscht kleinere Störungen nicht auf! Wenn es sich um eine kleinere Störung handelt, solltet ihr kein großes Thema daraus machen. Kleinere Störungen lassen sich mit einfachen Mitteln beseitigen oder enden von selbst. Folgende Reaktionsweisen sind zu empfehlen:
Diese Methoden funktionieren jedoch nur bei kleineren Störungen, die punktuell auftreten. Wenn eine Störung länger andauert, müsst ihr zu anderen Mitteln greifen: 3. Fragt nach, was stört! Wenn ihr keine Ahnung habt, woher eine Störung rührt, thematisiert die Störung: „Ich habe den Eindruck, du magst dem Unterricht nicht mehr folgen. Liege ich da richtig?“ Wenn der Störer bejaht, fragt ihr weiter: „Was stört dich?“ Oder: „Was kann ich tun, damit du wieder mitmachst?“ Der Störer wird sich nun entweder beruhigen oder einen mehr oder weniger sinnvollen Vorschlag machen, den ihr annehmen oder (begründet!) ablehnen könnt. In jedem Fall ist dem Störer bewusst, dass ihr seine Störung wahrgenommen habt. Das Störsignal ist angekommen und muss nicht länger gesendet werden. 4. Sorgt für Abwechslung und genügend Pausen!
Manchmal genügt es auch schon, wenn ihr eine Abwechslung in Aussicht stellt: „Wir sind gleich fertig mit dieser Übung. Danach gibt es einen kleinen Muntermacher!“ Wenn die Ursache einer Störung ein
Erholungsbedürfnis bzw. der Bewegungsdrang eurer Schüler ist,
macht eine Pause. Achtet dabei darauf, dass diese Pause möglichst
aktiv gestaltet wird. Vor allem jüngere Schüler*innen brauchen in der
Regel viel Bewegung. 5. Erinnert an Absprachen und den Sinn der Übung! Wenn eine Störung aus einem schwachen Sozialverhalten resultiert, kann es helfen, wenn ihr an die allgemeinen Spielregeln erinnert und an den Sinn für Fairness appelliert: „Wir haben abgemacht, dass jeder ausreden darf. Du willst auch nicht unterbrochen werden.“ – Oder: „Es ist nicht fair, wenn du die, die das noch nicht verstanden haben, jetzt ablenkst.“ An Regeln könnt ihr natürlich nur erinnern, wenn ihr welche vereinbart habt. Falls ihr keine vereinbart habt, ist eine Störung vielleicht ein guter Anlass, das nachzuholen. Wenn die Ursache der Störung ist, dass ein*e Schüler*in den Sinn der Übung nicht (mehr) erkennt, müsst ihr den noch einmal deutlich machen: „Mir scheint, dir ist nicht klar, wozu wir das brauchen. Habe ich Recht? – Ich versuche noch einmal, es zu erklären: ...“ 6. Setzt Belohnungen aus! Wenn die Störung daher rührt, dass anstrengende Arbeit geleistet werden muss, könnt ihr gelegentlich auch einmal mit Belohnungen arbeiten: „Diese Gummibärchen sind deine, wenn es dir gelingt, bis zum Ende der Stunde nicht mehr zu stören!“ Oder: „Wenn wir diese Übung jetzt schnell zum Ende bringen, haben wir anschließend noch Zeit für ein Spiel.“ 7. Setzt den Störenfried um! Wenn die Störung aus einer unguten Nachbarschaft resultiert, könnt ihr auch den Störer umsetzen. Das solltet ihr jedoch möglichst liebevoll machen, gut begründen und als vorübergehende Veränderung der Sitzordnung darstellen: „Ich möchte heute einmal ein kleines Experiment mit dir machen. Mal sehen, wie es ist, wenn du hier drüben sitzt. Ich könnte mir vorstellen, dass du dich da besser konzentrieren kannst.“ 8. Bittet den Störenfried zum Gespräch! Wenn ein*e Schüler*in dauerhaft stört und die genannten Mittel nicht greifen, bittet zum Gespräch. Dieses Gespräch sollte außerhalb des Unterrichts und unter vier Augen erfolgen, damit ihr möglichst offen und ehrlich reden könnt. (Das gilt auch dann, wenn ihr mehrere Störenfriede habt: Redet mit jedem einzeln!). Zunächst solltet ihr freundlich mitteilen, was ihr beobachtet habt. („Ich habe den Eindruck, der Förderunterricht hilft dir im Moment nicht viel. Es macht dir keinen Spaß. Du schaffst es nicht, dich auf den Unterricht einzulassen.“) Dann solltet ihr klären, warum euer Gegenüber am Förderunterricht teilnimmt, was es sich davon erhofft hatte, was stört, welche Unterrichts-Verbesserungen gewünscht sind. Und schließlich solltet ihr klare Vereinbarungen treffen. Vielleicht könnt ihr sogar einen kleinen Vertrag aufsetzen und unterschreiben lassen. Etwa so: Euer Gespräch sollte eurem Gegenüber bewusst machen, dass es selbst in der Hand hat, ob der Unterricht etwas bringt oder nicht. Die Mitverantwortung für das Gelingen des Unterrichts sollte deutlich werden. Sollte euer Schüler / eure Schülerin das nicht einsehen, müsst ihr Klartext reden. Entweder er / sie spielt nach den gültigen Spielregeln mit oder sollte ausscheiden: „Wenn du am Förderunterricht teilnehmen willst, muss du dich an unsere Regeln halten und mitarbeiten. Wenn du das nicht schaffst, solltest du nicht teilnehmen.“ 9. Holt Hilfe!
Deutet das nicht als Eingeständnis eigener Schwäche. Es zeugt nicht von Unvermögen, wenn ihr um Hilfe bittet. Im Gegenteil! Es gibt Probleme, die ihr allein einfach nicht lösen könnt. Hilfe braucht ihr vor allem, wenn ein Schüler / eine Schülerin sich nicht mehr
„bändigen“ lässt und eure Lerngruppe unter seiner / ihrer Anwesenheit massiv
leidet. Hilfe braucht ihr aber auch, wenn es in eurer Gruppe
dauerhaft starke Spannungen gibt, weil einige Schüler*innen sich ständig
Gefechte liefern. Wenn ihr den Eindruck habt, dass in der Gruppe
mehr gekämpft als gelernt wird, muss etwas geschehen. 10. Prüft, ob ihr euren Unterricht verbessern könnt! Grundsätzlich gilt: Je besser der Unterricht, desto seltener gibt es Störungen. Wenn ihr häufiger Disziplinprobleme bekommt, solltet ihr also euren Unterricht kritisch unter die Lupe nehmen und überlegen, wo ihr euch langfristig verbessern könnt, damit Störungen seltener werden. Gute Anregungen für eine kritische Selbstbefragung bietet der Fragebogen im Kapitel „Feedback beachten“. Den könnt ihr selbst ausfüllen oder auch von euren Schüler*innen ausfüllen lassen. Die Bewertungskriterien, bei denen ihr schlecht abschneidet, solltet ihr euch vornehmen: Überlegt (vielleicht auch zusammen mit euren Schüler*innen), welche konkreten Verbesserungen möglich sind: Vielleicht könnt ihr den Unterricht interessanter und abwechslungsreicher gestalten. Vielleicht könnte der Unterricht gezielter auf die Bedürfnisse der Schüler*innen eingehen. Vielleicht könntet ihr das Geschehen selbstbewusster lenken. Es gibt viele mögliche Erklärungen dafür, dass ein Unterricht besonders störanfällig ist. Schaut, ob und wie ihr euch hier verbessern könnt. Nehmt euch aber nicht zu viel auf einmal vor. Kleine konkrete, wirklich umsetzbare Schritte zur Veränderung sind besser als große Vorsätze, die aber Theorie bleiben.
|
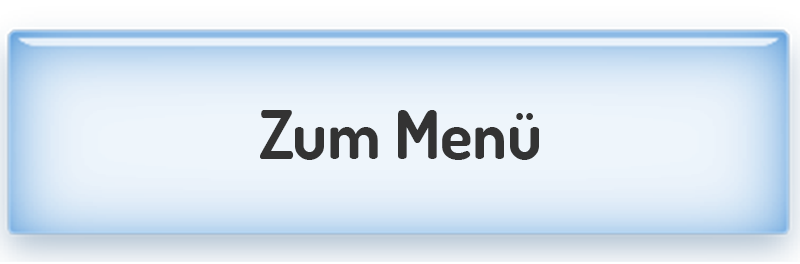
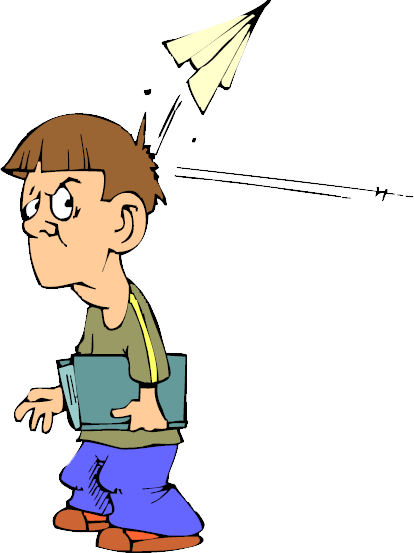 Schimpfen,
Schreien, Drohen – gibt es nicht! Niemals! Lasst euch unter keinen
Umständen zu solchen aggressiven Reaktionen hinreißen: Auch wenn ihr
für den Moment als Sieger dastehen mögt – langfristig seid ihr die
Verlierer: Ihr verspielt Sympathien, Respekt und Autorität.
Schimpfen,
Schreien, Drohen – gibt es nicht! Niemals! Lasst euch unter keinen
Umständen zu solchen aggressiven Reaktionen hinreißen: Auch wenn ihr
für den Moment als Sieger dastehen mögt – langfristig seid ihr die
Verlierer: Ihr verspielt Sympathien, Respekt und Autorität. Wenn
eine Störung aus Langeweile resultiert, wechselt das Thema
oder die Methode! Sobald ihr merkt, dass eine Unterrichtsphase
unterfordert oder monoton wird, schaltet um: „Ich sehe, diese Übung
kann euch nicht mehr fesseln. Lasst uns etwas Besseres suchen!“
Wenn
eine Störung aus Langeweile resultiert, wechselt das Thema
oder die Methode! Sobald ihr merkt, dass eine Unterrichtsphase
unterfordert oder monoton wird, schaltet um: „Ich sehe, diese Übung
kann euch nicht mehr fesseln. Lasst uns etwas Besseres suchen!“ 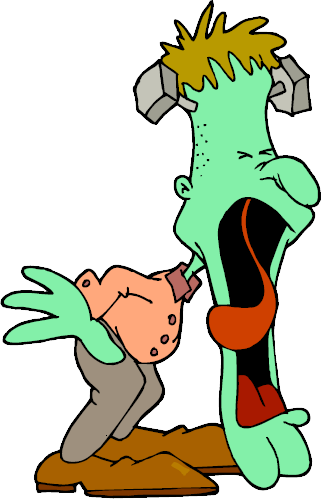 Wenn
ihr selbst kein erfolgreiches Mittel gegen die Störung findet,
holt euch Hilfe von Lehrer*innen oder den Eltern eurer Schüler*innen.
Wenn
ihr selbst kein erfolgreiches Mittel gegen die Störung findet,
holt euch Hilfe von Lehrer*innen oder den Eltern eurer Schüler*innen.